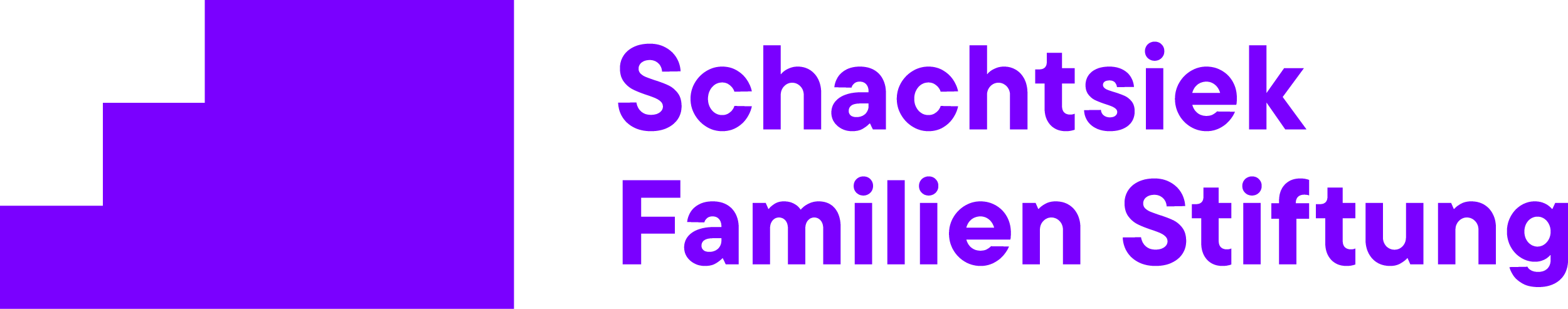
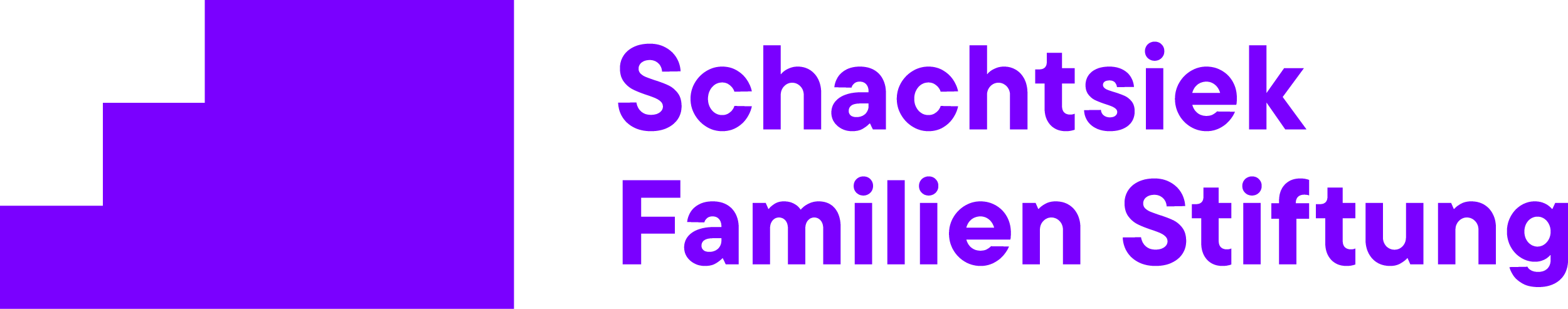
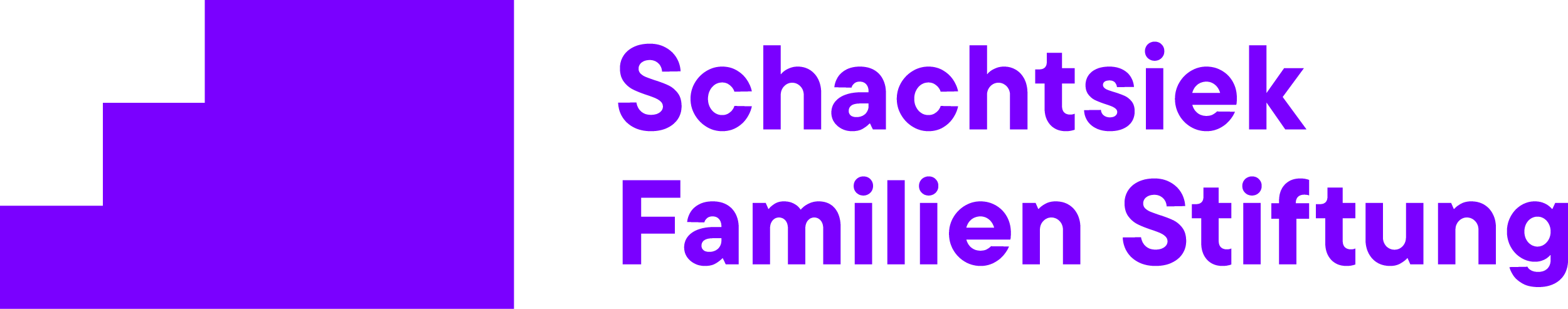
Journal

© Monika Werneke
Bernd Schachtsiek ist Stifter der Schachtsiek Familien Stiftung. Im Interview spricht er über seine persönliche Motivation für die Stiftung, sein langjähriges Engagement für die queere Community, neue Möglichkeiten für das Musiktheater und wieso ihn einst die Klänge von Wagner zu Tränen gerührt haben.
Was ist Ihre persönliche Motivation für die Stiftung?
Ich bin in dem Bewusstsein erzogen worden, mir stets darüber im Klaren zu sein, wie privilegiert ich bin und deshalb auch verpflichtet bin, denen zu helfen, die nicht so privilegiert sind. Das war das Credo meiner Mutter. Sie hat immer gesagt: „Du wächst in einer behüteten und finanziell stabilen Umgebung auf und deswegen trägst du Verantwortung für andere.“ Dieses Verantwortungsgefühl hat mich eigentlich immer getragen.
Die Stiftung möchte sich vor allem für die LSBTIQ-Community einsetzen.
Dass das Thema so eine große Rolle spielt, hat damit zu tun, dass das Herausfinden meiner Sexualität einer der prägendsten Tiefpunkte meines Lebens war. Ich war zu dem Zeitpunkt verheiratet, hatte ein Kind und stellte plötzlich fest: Ich bin gar nicht der, der ich sein wollte oder der ich dachte zu sein. Das stellte mich vor die Entscheidung: Kann ich das unterdrücken und ein Leben mit einer Lüge leben oder nehme ich in Kauf, dass ich viele Menschen um mich herum unglücklich mache und suche den Schnitt? Ich habe mich dazu entschieden, den Schnitt zu machen – was jedoch zu großen Schuldgefühlen bei mir geführt hat. Da war klar, ich möchte anderen, die sich in ähnlichen Situationen befinden, eine Chance geben, anders, vielleicht sogar besser damit umzugehen. Heißt, sich früher zu outen, früher zu erkennen, wer man ist.
Also offener und direkter mit dem Thema umgehen?
Deswegen habe ich aus meiner Homosexualität nie einen Hehl gemacht. Das ist einer der Gründe, warum ich mich engagiere, auch weil ich in meiner eigenen Familie erlebt habe, wie schwierig und komplex diese Prozesse sein können.
Welche Rolle spielt Unternehmergeist für die Stiftung?
Ich habe zu Hause beigebracht bekommen, Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu übernehmen. Ich wusste zwar, ich leite und habe Einfluss, aber ohne die anderen geht es nicht. Man ist immer ein Team. Nicht zuletzt geht es auch um die Bäckereikette Biokaiser, an der die Stiftung beteiligt und die die Hauptgeldgeberin der Stiftung ist (biokaiser.de). Die Stiftung hat die Aufgabe, die Bio-Bäckerei, die am Gemeinwohl orientiert ist, auch in diesem Sinne zukünftig fortzuführen. Wir wollen nicht nur etwas Gutes für die Umwelt tun, sondern teilen unsere Erträge mit unseren Stakeholdern, also Lieferanten, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und auch mit Menschen in unserem Umfeld, die uns beeinflussen. Dazu zählen Künstler und Menschen, die zum Beispiel in den Bereichen Nachhaltigkeit und Ökologie arbeiten. Mir ist wichtig, dass die Bäckerei im Sinne des Gemeinwohls weitergeführt und kein klassisch rein gewinnorientiertes Unternehmen daraus wird.
Nicht zuletzt geht es in der Stiftung aber auch um Ihre Liebe zum Musiktheater?
Das ist meine große persönliche Leidenschaft. Für mich ist Musiktheater immer auch Erholung, und ich bedauere, dass das typische Opernpublikum so alt geworden ist. Da würde ich gerne wieder junge Leute an das Musiktheater ranführen und Projekte unterstützen, die den Zugang erleichtern. Musiktheater ist so viel mehr als die traditionelle Oper, wie sie vor 100 Jahren gemeint war.
Während Ihres Coming-outs, wie würden Sie das gesellschaftliche Klima zu der Zeit beschreiben?
Ich habe 1968 Abitur gemacht und habe danach angefangen zu studieren. Ich war kein Linker, weil ich aus einem Unternehmerhaushalt komme und da sieht man automatisch gewisse Themen ein bisschen anders. Ich habe damals experimentiert und mich ganz bewusst gegen die herrschende Werteordnung gestellt. Die Gesellschaft war nicht so liberal wie heute. Als ich mein Coming-out in den 80ern hatte, stellte ich fest, dass ich durch meine beruflichen Erfolge eine gewisse Wertschätzung genoss – dass die Leute anders mit mir umgegangen sind als mit anderen Menschen, die sich ebenfalls geoutet haben. Zwar bin ich nie persönlich angegriffen worden, es ging aber nicht allen so. Was plötzlich passierte, war, dass auch andere verheiratete Männer zu mir kamen und meinen Rat gesucht haben, weil sie mit etwas Ähnlichem zu kämpfen hatten. Viele haben sich dennoch dagegen entschieden. Sie fühlten sich nicht stark genug, diesen Schritt zu wagen.
Später kamen das Engagement im Völklinger Kreis und anderen Verbänden dazu. Welche Aufgaben haben Sie übernommen?
So richtig engagiert habe ich mich erst, als ich mich mit Anfang 50 beruflich sukzessive zurückgezogen habe. Da war mir klar, ich will der Gesellschaft etwas zurückgeben, auch weil sie mir meinen Erfolg ermöglicht hat. Ich habe mich im Völklinger Kreis engagiert, dem Bundesverband schwuler Führungskräfte und Selbstständiger. Ich bin ehrenamtlicher Handelsrichter geworden, wie auch Vorstand in der Aidshilfe in Wiesbaden. Parallel fing ich als Coach und Mentor an – für Leute, die Hilfe brauchen, sich aber keinen teuren Berater leisten konnten. Für mich war das unheimlich bereichernd, weil ich dadurch ganz unterschiedliche Lebensmodelle kennenlernen konnte. Gerade wenn es um das schwul-lesbische Thema geht oder auch ums Musiktheater, ist beides oft hoch emotional, wodurch man anders mit Menschen in Kontakt tritt. Es hat mir geholfen, mich selber nochmal infrage zu stellen und etwas über mich herauszufinden. Vor allem schätze ich den Austausch mit jüngeren Menschen, was im Berufsleben immer seltener gegeben war.
Wann waren Sie das erste Mal im Musiktheater?
Als Kind war ich mit meinen Großeltern in der Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld zum Sonntagsvormittagsprogramm. Das waren eher klassische Konzerte, weniger Musiktheater, die gezielt an jüngere Leute gerichtet waren. Mit dem Musiktheater ging es erst mit Anfang 30 bei mir los. Mein erster Mann nach meinem Coming-out war großer Fan von Maria Callas. Mir war das zunächst zu anstrengend, aber er hat mir diese Welt dennoch näher gebracht. Dazu gehören auch Operetten und vor allen Dingen das Musical. An meinem Zweitwohnsitz New York habe ich am Broadway Musicals in einer Qualität kennen gelernt, die mich tief beeindruckt hat.
Bei welcher Aufführung hat es „Klick“ gemacht?
Die größte Gänsehaut gab es bei Tristan und Isolde von Richard Wagner im Staatstheater Mainz. Ich habe den ganzen letzten Akt geweint. Die Musik von Wagner und wie das Thema Tod behandelt wird, hat mich einfach gepackt. Ich bin, was Gefühle angeht, eher ein kontrollierter Mensch. Aber die Musik hat mich mitgenommen. Ich konnte darin wegschwimmen. Und wenn jemand auf der Bühne in der Lage ist, glaubhaft die Rolle zu verkörpern, dann finde ich, ist es das Größte, was es gibt.
Was kam nach Wagner?
Wagner ist in der Lage, über die Musik Geschichten und Gefühle zu transportieren. Da brauche ich nicht viele Worte. Das nächste Wunder ist mir mit Mozart passiert. Bei Mozart gibt es Arien, die die Handlung transportieren, während die Musik erzählt, was die Personen tatsächlich denken. Mozart kann wundervoll über die Musik Gedanken transportieren, die häufig von dem abweichen, was tatsächlich auf der Bühne gezeigt wird. Da braucht man ein bisschen Zeit, man muss sich das öfter anhören. Es klingt oft gefällig, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so, wenn man sich einmal reinversetzt hat. Das fasziniert mich.
Der Musikforscher Kevin Clarke schreibt, dass es historisch gesehen schon viel länger Zusammenhänge zwischen queerer Kultur und Musiktheater gibt.
Wenn ich mir die Oper als Institution angucke, finde ich sie genauso konservativ wie die Gesellschaft. Da gibt es genauso auch homophobe Strömungen. In der Oper hat es immer Figuren gegeben, die mit diesen Themen spielen. Da stört mich oft, dass das eher stereotyp abgehandelt wird. Die Komplexität der Menschen wird vereinfacht. Oper ist heute ein sehr bürgerliches Thema. Aber ich finde, dass Oper mehr zu bieten hat, wenn man sie richtig erzählt und wenn man sie eben nicht als Museum behandelt.
Was kann man tun, um auch junge Leute mehr für das Thema Musiktheater zu begeistern oder zu erreichen?
Mehr experimentieren! Ich unterstütze in New York die Operngruppe Heartbeat Opera. Hier werden Opern auf Spielfilmlänge gekürzt, ohne sie zu verfälschen, und man ist damit bei jungen Leuten relativ erfolgreich. Die wenigsten haben Lust, sich vier Stunden in ein „steifes Opernhaus“ zu setzen. Aber die Heartbeat Opera zieht junge Menschen an und begeistert sie. Ein klassisches Opernhaus mit all seinen Ritualen ist eine Hemmschwelle für viele, die das von zu Hause aus nicht gewöhnt sind. Mir geht es darum, dass wir guten Ideen eine Chance geben, die im normalen Opernbetrieb nicht funktionieren würden.
Es braucht also eine breitere Förderlandschaft jenseits der öffentlichen Kulturförderung?
Ja, vor allen Dingen, weil Oper sehr aufwendig ist. Man braucht Bühne, Schauspieler und ein Orchester. Es sind viele Menschen involviert. Deswegen ist es für Off-Bühnen schwieriger Opern zu inszenieren als Theaterstücke. Wir haben in Berlin ein paar Bühnen, die versuchen, da anders ran zu gehen, was mir sehr gefällt.
Gibt es einen Austausch mit anderen Stiftungen?
Wir tauschen uns mit anderen Stiftungen aus und möchten das intensivieren. Man kann voneinander lernen – was man vermeiden soll oder was besser funktioniert. Bei vielen Projekten brauchen wir wahrscheinlich auch mehr als eine Stiftung, um sie realisieren zu können. Da ist es hilfreich, wenn man gemeinsam die Strukturen kennt und weiß, wo noch Möglichkeiten bestehen, größere Finanzierungen oder Netzwerke zu ermöglichen. Ich freue mich sehr auf den Austausch, auch dass mir jemand sagt: Lass das besser und konzentriere dich auf was anderes, bevor du dir die Zähne ausbeißt.
Was gibt es über die aktuellen Förderprojekte zu erzählen?
Derzeit liegt der Fokus noch gar nicht so sehr auf Musiktheater. Wir helfen bei Projekten, Eigenmittel aufzubringen, die z.B. vom Berliner Senat gefördert werden. Ein mir wichtiges Projekt ist Gemeinsam Einsam in Berlin. Hier geht es um das komplexe Thema Einsamkeit und Alter in der queeren Community. Wir wollen aktiv Lebenshilfen unterstützen. Hier beraten wir auch, stabile Organisationen zu schaffen, was im Sektor Ehrenamt nicht immer leicht ist. Die Initiative Queermed bietet Hilfe bei der Suche nach sensibilisierten ärztlichen und therapeutischen Praxen. Oder auch das geplante Archivzentrum in Neukölln, was mir wirklich am Herzen liegt. Das sind alles Bereiche, die für die Stiftung eine enorme Bedeutung haben. Da wissen wir, dass Menschen dahinter stecken, die hoch engagiert sind und die Garantie bieten, dass unsere Förderungen sinnvoll und nachhaltig eingesetzt werden.
Journal

© Monika Werneke
Bernd Schachtsiek ist Stifter der Schachtsiek Familien Stiftung. Im Interview spricht er über seine persönliche Motivation für die Stiftung, sein langjähriges Engagement für die queere Community, neue Möglichkeiten für das Musiktheater und wieso ihn einst die Klänge von Wagner zu Tränen gerührt haben.
Was ist Ihre persönliche Motivation für die Stiftung?
Ich bin in dem Bewusstsein erzogen worden, mir stets darüber im Klaren zu sein, wie privilegiert ich bin und deshalb auch verpflichtet bin, denen zu helfen, die nicht so privilegiert sind. Das war das Credo meiner Mutter. Sie hat immer gesagt: „Du wächst in einer behüteten und finanziell stabilen Umgebung auf und deswegen trägst du Verantwortung für andere.“ Dieses Verantwortungsgefühl hat mich eigentlich immer getragen.
Die Stiftung möchte sich vor allem für die LSBTIQ-Community einsetzen.
Dass das Thema so eine große Rolle spielt, hat damit zu tun, dass das Herausfinden meiner Sexualität einer der prägendsten Tiefpunkte meines Lebens war. Ich war zu dem Zeitpunkt verheiratet, hatte ein Kind und stellte plötzlich fest: Ich bin gar nicht der, der ich sein wollte oder der ich dachte zu sein. Das stellte mich vor die Entscheidung: Kann ich das unterdrücken und ein Leben mit einer Lüge leben oder nehme ich in Kauf, dass ich viele Menschen um mich herum unglücklich mache und suche den Schnitt? Ich habe mich dazu entschieden, den Schnitt zu machen – was jedoch zu großen Schuldgefühlen bei mir geführt hat. Da war klar, ich möchte anderen, die sich in ähnlichen Situationen befinden, eine Chance geben, anders, vielleicht sogar besser damit umzugehen. Heißt, sich früher zu outen, früher zu erkennen, wer man ist.
Also offener und direkter mit dem Thema umgehen?
Deswegen habe ich aus meiner Homosexualität nie einen Hehl gemacht. Das ist einer der Gründe, warum ich mich engagiere, auch weil ich in meiner eigenen Familie erlebt habe, wie schwierig und komplex diese Prozesse sein können.
Welche Rolle spielt Unternehmergeist für die Stiftung?
Ich habe zu Hause beigebracht bekommen, Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu übernehmen. Ich wusste zwar, ich leite und habe Einfluss, aber ohne die anderen geht es nicht. Man ist immer ein Team. Nicht zuletzt geht es auch um die Bäckereikette Biokaiser, an der die Stiftung beteiligt und die die Hauptgeldgeberin der Stiftung ist (biokaiser.de). Die Stiftung hat die Aufgabe, die Bio-Bäckerei, die am Gemeinwohl orientiert ist, auch in diesem Sinne zukünftig fortzuführen. Wir wollen nicht nur etwas Gutes für die Umwelt tun, sondern teilen unsere Erträge mit unseren Stakeholdern, also Lieferanten, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und auch mit Menschen in unserem Umfeld, die uns beeinflussen. Dazu zählen Künstler und Menschen, die zum Beispiel in den Bereichen Nachhaltigkeit und Ökologie arbeiten. Mir ist wichtig, dass die Bäckerei im Sinne des Gemeinwohls weitergeführt und kein klassisch rein gewinnorientiertes Unternehmen daraus wird.
Nicht zuletzt geht es in der Stiftung aber auch um Ihre Liebe zum Musiktheater?
Das ist meine große persönliche Leidenschaft. Für mich ist Musiktheater immer auch Erholung, und ich bedauere, dass das typische Opernpublikum so alt geworden ist. Da würde ich gerne wieder junge Leute an das Musiktheater ranführen und Projekte unterstützen, die den Zugang erleichtern. Musiktheater ist so viel mehr als die traditionelle Oper, wie sie vor 100 Jahren gemeint war.
Während Ihres Coming-outs, wie würden Sie das gesellschaftliche Klima zu der Zeit beschreiben?
Ich habe 1968 Abitur gemacht und habe danach angefangen zu studieren. Ich war kein Linker, weil ich aus einem Unternehmerhaushalt komme und da sieht man automatisch gewisse Themen ein bisschen anders. Ich habe damals experimentiert und mich ganz bewusst gegen die herrschende Werteordnung gestellt. Die Gesellschaft war nicht so liberal wie heute. Als ich mein Coming-out in den 80ern hatte, stellte ich fest, dass ich durch meine beruflichen Erfolge eine gewisse Wertschätzung genoss – dass die Leute anders mit mir umgegangen sind als mit anderen Menschen, die sich ebenfalls geoutet haben. Zwar bin ich nie persönlich angegriffen worden, es ging aber nicht allen so. Was plötzlich passierte, war, dass auch andere verheiratete Männer zu mir kamen und meinen Rat gesucht haben, weil sie mit etwas Ähnlichem zu kämpfen hatten. Viele haben sich dennoch dagegen entschieden. Sie fühlten sich nicht stark genug, diesen Schritt zu wagen.
Später kamen das Engagement im Völklinger Kreis und anderen Verbänden dazu. Welche Aufgaben haben Sie übernommen?
So richtig engagiert habe ich mich erst, als ich mich mit Anfang 50 beruflich sukzessive zurückgezogen habe. Da war mir klar, ich will der Gesellschaft etwas zurückgeben, auch weil sie mir meinen Erfolg ermöglicht hat. Ich habe mich im Völklinger Kreis engagiert, dem Bundesverband schwuler Führungskräfte und Selbstständiger. Ich bin ehrenamtlicher Handelsrichter geworden, wie auch Vorstand in der Aidshilfe in Wiesbaden. Parallel fing ich als Coach und Mentor an – für Leute, die Hilfe brauchen, sich aber keinen teuren Berater leisten konnten. Für mich war das unheimlich bereichernd, weil ich dadurch ganz unterschiedliche Lebensmodelle kennenlernen konnte. Gerade wenn es um das schwul-lesbische Thema geht oder auch ums Musiktheater, ist beides oft hoch emotional, wodurch man anders mit Menschen in Kontakt tritt. Es hat mir geholfen, mich selber nochmal infrage zu stellen und etwas über mich herauszufinden. Vor allem schätze ich den Austausch mit jüngeren Menschen, was im Berufsleben immer seltener gegeben war.
Wann waren Sie das erste Mal im Musiktheater?
Als Kind war ich mit meinen Großeltern in der Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld zum Sonntagsvormittagsprogramm. Das waren eher klassische Konzerte, weniger Musiktheater, die gezielt an jüngere Leute gerichtet waren. Mit dem Musiktheater ging es erst mit Anfang 30 bei mir los. Mein erster Mann nach meinem Coming-out war großer Fan von Maria Callas. Mir war das zunächst zu anstrengend, aber er hat mir diese Welt dennoch näher gebracht. Dazu gehören auch Operetten und vor allen Dingen das Musical. An meinem Zweitwohnsitz New York habe ich am Broadway Musicals in einer Qualität kennen gelernt, die mich tief beeindruckt hat.
Bei welcher Aufführung hat es „Klick“ gemacht?
Die größte Gänsehaut gab es bei Tristan und Isolde von Richard Wagner im Staatstheater Mainz. Ich habe den ganzen letzten Akt geweint. Die Musik von Wagner und wie das Thema Tod behandelt wird, hat mich einfach gepackt. Ich bin, was Gefühle angeht, eher ein kontrollierter Mensch. Aber die Musik hat mich mitgenommen. Ich konnte darin wegschwimmen. Und wenn jemand auf der Bühne in der Lage ist, glaubhaft die Rolle zu verkörpern, dann finde ich, ist es das Größte, was es gibt.
Was kam nach Wagner?
Wagner ist in der Lage, über die Musik Geschichten und Gefühle zu transportieren. Da brauche ich nicht viele Worte. Das nächste Wunder ist mir mit Mozart passiert. Bei Mozart gibt es Arien, die die Handlung transportieren, während die Musik erzählt, was die Personen tatsächlich denken. Mozart kann wundervoll über die Musik Gedanken transportieren, die häufig von dem abweichen, was tatsächlich auf der Bühne gezeigt wird. Da braucht man ein bisschen Zeit, man muss sich das öfter anhören. Es klingt oft gefällig, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so, wenn man sich einmal reinversetzt hat. Das fasziniert mich.
Der Musikforscher Kevin Clarke schreibt, dass es historisch gesehen schon viel länger Zusammenhänge zwischen queerer Kultur und Musiktheater gibt.
Wenn ich mir die Oper als Institution angucke, finde ich sie genauso konservativ wie die Gesellschaft. Da gibt es genauso auch homophobe Strömungen. In der Oper hat es immer Figuren gegeben, die mit diesen Themen spielen. Da stört mich oft, dass das eher stereotyp abgehandelt wird. Die Komplexität der Menschen wird vereinfacht. Oper ist heute ein sehr bürgerliches Thema. Aber ich finde, dass Oper mehr zu bieten hat, wenn man sie richtig erzählt und wenn man sie eben nicht als Museum behandelt.
Was kann man tun, um auch junge Leute mehr für das Thema Musiktheater zu begeistern oder zu erreichen?
Mehr experimentieren! Ich unterstütze in New York die Operngruppe Heartbeat Opera. Hier werden Opern auf Spielfilmlänge gekürzt, ohne sie zu verfälschen, und man ist damit bei jungen Leuten relativ erfolgreich. Die wenigsten haben Lust, sich vier Stunden in ein „steifes Opernhaus“ zu setzen. Aber die Heartbeat Opera zieht junge Menschen an und begeistert sie. Ein klassisches Opernhaus mit all seinen Ritualen ist eine Hemmschwelle für viele, die das von zu Hause aus nicht gewöhnt sind. Mir geht es darum, dass wir guten Ideen eine Chance geben, die im normalen Opernbetrieb nicht funktionieren würden.
Es braucht also eine breitere Förderlandschaft jenseits der öffentlichen Kulturförderung?
Ja, vor allen Dingen, weil Oper sehr aufwendig ist. Man braucht Bühne, Schauspieler und ein Orchester. Es sind viele Menschen involviert. Deswegen ist es für Off-Bühnen schwieriger Opern zu inszenieren als Theaterstücke. Wir haben in Berlin ein paar Bühnen, die versuchen, da anders ran zu gehen, was mir sehr gefällt.
Gibt es einen Austausch mit anderen Stiftungen?
Wir tauschen uns mit anderen Stiftungen aus und möchten das intensivieren. Man kann voneinander lernen – was man vermeiden soll oder was besser funktioniert. Bei vielen Projekten brauchen wir wahrscheinlich auch mehr als eine Stiftung, um sie realisieren zu können. Da ist es hilfreich, wenn man gemeinsam die Strukturen kennt und weiß, wo noch Möglichkeiten bestehen, größere Finanzierungen oder Netzwerke zu ermöglichen. Ich freue mich sehr auf den Austausch, auch dass mir jemand sagt: Lass das besser und konzentriere dich auf was anderes, bevor du dir die Zähne ausbeißt.
Was gibt es über die aktuellen Förderprojekte zu erzählen?
Derzeit liegt der Fokus noch gar nicht so sehr auf Musiktheater. Wir helfen bei Projekten, Eigenmittel aufzubringen, die z.B. vom Berliner Senat gefördert werden. Ein mir wichtiges Projekt ist Gemeinsam Einsam in Berlin. Hier geht es um das komplexe Thema Einsamkeit und Alter in der queeren Community. Wir wollen aktiv Lebenshilfen unterstützen. Hier beraten wir auch, stabile Organisationen zu schaffen, was im Sektor Ehrenamt nicht immer leicht ist. Die Initiative Queermed bietet Hilfe bei der Suche nach sensibilisierten ärztlichen und therapeutischen Praxen. Oder auch das geplante Archivzentrum in Neukölln, was mir wirklich am Herzen liegt. Das sind alles Bereiche, die für die Stiftung eine enorme Bedeutung haben. Da wissen wir, dass Menschen dahinter stecken, die hoch engagiert sind und die Garantie bieten, dass unsere Förderungen sinnvoll und nachhaltig eingesetzt werden.
Schachtsiek Familien Stiftung
Vorstand: Jörg Litwinschuh-Barthel, Bernd Schachtsiek
Kuratorium: Prof. Dr. Patrick Griesar, Lars Molsen, Joachim Odenbach
Tel: +49-30-206-3393-21
E-Mail: info@schachtsiek.org
Schachtsiek Familien Stiftung
Vorstand: Jörg Litwinschuh-Barthel, Bernd Schachtsiek
Kuratorium: Prof. Dr. Patrick Griesar, Lars Molsen, Joachim Odenbach
Tel: +49-30-206-3393-21
E-Mail: info@schachtsiek.org
Um dir ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn du diesen Technologien zustimmst, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn du deine Zustimmung nicht erteilst oder zurückziehst, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.